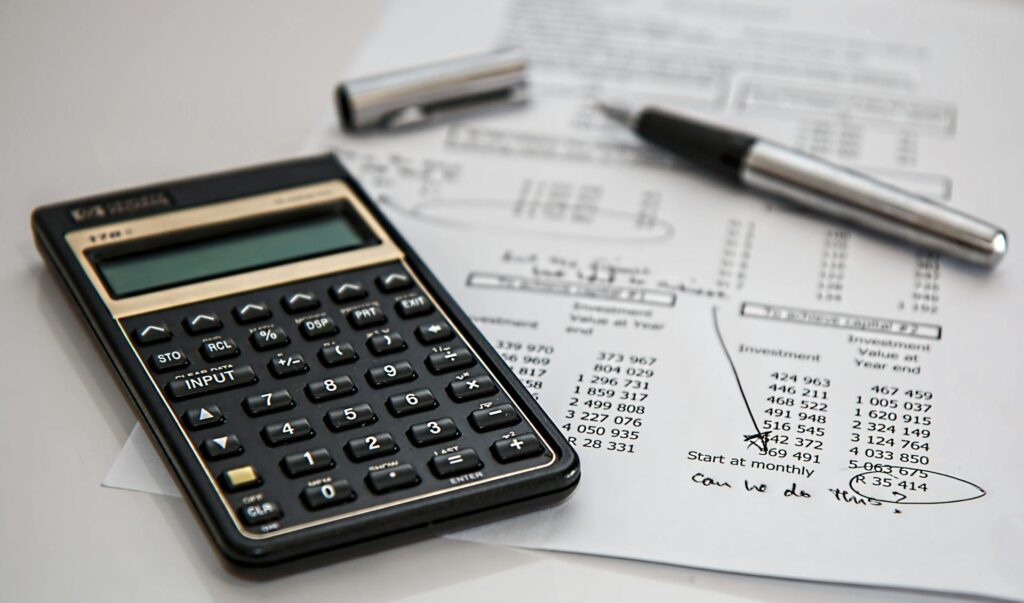Werklieferungen im österreichischen Umsatzsteuerrecht

Ausländische Anlagenbauer, die in Österreich tätig werden, müssen das Konzept der Werklieferung genau kennen. Dieser Fachartikel erklärt, was Werklieferungen sind und wie sie umsatzsteuerlich in Österreich behandelt werden. Er bietet praxisorientierte Hinweise – von Registrierungspflichten bis zur Rolle des Fiskalvertreters in Österreich – um ausländischen Unternehmen echten Mehrwert zu bieten.
Werklieferungen sind keine alltäglichen Standardgeschäfte, sondern komplexe Leistungen, die Elemente von Warenlieferung und Dienstleistung vereinen. Gerade im internationalen Anlagenbau führt dies zu zahlreichen steuerlichen Fragen: Wo ist der Umsatz zu versteuern? Wie erfolgt die Rechnungsstellung korrekt? Welche Pflichten entstehen gegenüber dem Finanzamt? Fehler bei der Beurteilung können zu Doppelbesteuerung oder Sanktionen führen. Insbesondere muss die Umsatzsteuer bei einer Werklieferung aus dem Ausland vorab eindeutig geklärt sein, damit es nicht zu Missverständnissen zwischen Lieferant und Kunde kommt. Die folgenden Abschnitte geben einen strukturierten Überblick – von der Definition über die steuerliche Behandlung bis hin zu praktischen Umsetzungstipps – damit ausländische Unternehmer ihre Projekte in Österreich sicher und erfolgreich abwickeln können.
Definition der Werklieferung
Unter einer Werklieferung versteht man vereinfacht gesprochen einen Lieferauftrag mit Montage, bei dem der Lieferant nicht nur Waren liefert, sondern diese auch beim Kunden einbaut oder verarbeitet. Rechtlich präzise wird der Begriff in Österreich durch § 3 Abs. 4 Umsatzsteuergesetz (UStG) definiert. Eine Werklieferung liegt demnach vor, wenn ein Unternehmer einen vom Auftraggeber bereitgestellten Gegenstand bearbeitet oder verarbeitet und dabei eigene Hauptstoffe verwendet. Das bedeutet: Der Kunde stellt etwas zur Verfügung (z.B. eine Maschine, ein Gebäude oder ein Bauteil) und der liefernde Unternehmer integriert seine eigenen Materialien wesentlich in dieses Werk.
Wichtig ist, dass die eingebrachten Materialien des Lieferanten keine bloßen Nebensachen (Zutaten oder Hilfsstoffe) sind, sondern für das fertige Werk den Kern ausmachen. Werklieferungen im Anlagenbau umfassen typischerweise die Lieferung umfangreicher Anlagenkomponenten kombiniert mit deren Installation vor Ort beim Kunden. Ein klassisches Beispiel hierfür ist der Einbau eines speziell für die Produktionsanlage des Kunden gefertigten Schaltschrankes direkt in die bestehende Anlage. Durch die feste Verbindung mit der Kundeneinrichtung wird deutlich: Es handelt sich nicht um eine bloße Warenlieferung, sondern um eine einheitliche Leistung aus Lieferung und Montage.
Abzugrenzen ist die Werklieferung von der sogenannten Werkleistung. Bei einer Werkleistung erbringt der Unternehmer zwar ebenfalls eine Arbeit für den Kunden, verwendet dabei aber keine eigenen Hauptstoffe, sondern hauptsächlich vom Auftraggeber gestellte Materialien. Im Umsatzsteuerrecht gilt eine Werkleistung als sonstige Dienstleistung und nicht als Lieferung. Die Unterscheidung hat Folgen für den Leistungsort und die steuerliche Behandlung, worauf im nächsten Abschnitt näher eingegangen wird.
Ebenfalls abzugrenzen ist eine Werklieferung von einer reinen Warenlieferung ohne Montage. Liefert ein ausländischer Unternehmer eine Anlage lediglich bis zur Türschwelle des Kunden (ohne jegliche Montage oder Bearbeitung vor Ort), handelt es sich um eine gewöhnliche Warenlieferung. In einem solchen Fall greifen die üblichen umsatzsteuerlichen Regeln für den grenzüberschreitenden Warenverkehr: Bei Lieferung an einen österreichischen Unternehmer lässt sich der Vorgang etwa als innergemeinschaftliche Lieferung (0% Umsatzsteuer) abwickeln, während bei Lieferung aus einem Drittland der Importeur die Einfuhrumsatzsteuer entrichtet. Erst durch die Kombination von Lieferung und Montage wird aus der Warenlieferung eine steuerlich eigenständige Werklieferung.
Steuerliche Behandlung von Werklieferungen
Die umsatzsteuerliche Behandlung einer Werklieferung hängt maßgeblich vom Leistungsort ab. Gemäß den EU-Mehrwertsteuervorschriften (Richtlinie 2006/112/EG) und österreichischem UStG wird bei Lieferungen mit Montage der Ort der tatsächlichen Montage als Leistungsort definiert. Findet die Montage in Österreich statt, unterliegt die gesamte Werklieferung der österreichischen Umsatzsteuer – unabhängig davon, wo der Lieferant seinen Firmensitz hat oder von wo die gelieferten Teile stammen. Für ausländische Unternehmer im Anlagenbau bedeutet dies, dass sie sich bei Projekten in Österreich mit dem lokalen Umsatzsteuerrecht auseinandersetzen müssen.
Reverse-Charge-Verfahren (Umkehr der Steuerschuld): In vielen Fällen greift in Österreich jedoch das Reverse-Charge-Verfahren, wenn ein ausländischer Unternehmer eine Werklieferung erbringt. Reverse Charge bedeutet, dass nicht der Leistende, sondern der Leistungsempfänger die Umsatzsteuerschuld trägt. Konkret gilt: Erbringt ein im Ausland ansässiger Unternehmer eine steuerpflichtige Werklieferung in Österreich an einen Unternehmer oder an eine juristische Person des öffentlichen Rechts, dann muss der österreichische Leistungsempfänger die Umsatzsteuer selbst an das Finanzamt abführen. Der ausländische Anlagenbauer stellt in diesem B2B-Fall seine Rechnung ohne österreichische Umsatzsteuer aus, weist aber ausdrücklich auf die „Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers“ hin (z.B. mit dem Vermerk „Reverse Charge“) und gibt die UID-Nummer des österreichischen Kunden an.
Durch das Reverse-Charge-System wird vermieden, dass sich ausländische Unternehmen in Österreich für einmalige Projekte umsatzsteuerlich registrieren müssen – zumindest solange ihre Leistung an einen steuerpflichtigen Unternehmer in Österreich erfolgt. Anders ist die Lage im B2C-Fall: Erbringt der ausländische Unternehmer eine Werklieferung gegenüber einer Privatperson oder einem Nichtunternehmer in Österreich, greift Reverse Charge nicht. In diesem Fall muss der ausländische Lieferant die österreichische Umsatzsteuer in Rechnung stellen (derzeit 20% Standardsatz) und diese an das Finanzamt abführen.
Zu beachten ist, dass die korrekte Einstufung als Werklieferung verhindert, dass Teile der Leistung fälschlich als umsatzsteuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung behandelt werden. Sobald nämlich eine Montage in Österreich Teil des Leistungsumfangs ist, gilt die gesamte Leistung als in Österreich ausgeführt. Ausländische Unternehmen dürfen daher z.B. nicht den Warenanteil einfach mit 0% (innergemeinschaftlich steuerfrei) fakturieren und nur die Montage getrennt besteuern. Vielmehr ist die Leistung einheitlich als Werklieferung in Österreich zu behandeln. Eine Fehlbehandlung kann zu Steuernachforderungen und Problemen bei Betriebsprüfungen führen. Zusätzlich darf der ausländische Unternehmer diese Leistung auch nicht versehentlich im eigenen Land der Umsatzsteuer unterwerfen – die Werklieferung ist ausschließlich in Österreich steuerbar (entweder über den Kunden via Reverse Charge oder durch eigene Veranlagung in Österreich).
Umsatzsteuerliche Registrierungspflichten ausländischer Unternehmer
Führt ein ausländischer Unternehmer in Österreich umsatzsteuerpflichtige Umsätze aus, stellt sich die Frage der Registrierungspflicht. Bei Werklieferungen im Ausland (aus Sicht Österreichs) gilt: Dank Reverse Charge muss sich ein Lieferant ohne Sitz in Österreich in B2B-Fällen zwar meist nicht selbst für die Umsatzsteuer registrieren lassen. Sobald jedoch eine Werklieferung an Nicht-Unternehmer (z.B. private Abnehmer) oder in bestimmten anderen Konstellationen erfolgt, besteht Registrierungspflicht in Österreich. Das Unternehmen muss sich beim zuständigen Finanzamt melden und eine österreichische Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (UID) beantragen, um die Umsatzsteuer korrekt abzuführen.
In der Praxis dürfte der B2C-Anwendungsfall im Anlagenbau selten sein, da große Anlagen meist von Unternehmen bestellt werden. Sollte aber doch ein Privatkunde oder eine nicht vorsteuerabzugsberechtigte Organisation in Österreich beliefert und montiert werden (etwa eine außerhalb des Unternehmensbereichs stehende Institution), kommt man an einer Steuerregistrierung nicht vorbei. Ab dem ersten Euro Umsatz in Österreich (anders als bei inländischen Kleinunternehmern gibt es für ausländische Firmen keinen Freibetrag) ist dann eine UID-Nummer zu beantragen. Die österreichische Kleinunternehmerregelung (Umsatz bis €55.000 jährlich steuerfrei) kann von im Ausland ansässigen Unternehmen grundsätzlich nicht in Anspruch genommen werden. Selbst wenn die Umsätze gering wären, müssen ausländische Anbieter für steuerpflichtige Werklieferungen eine reguläre Registrierung vornehmen.
Ein Spezialfall ist zu beachten, wenn ein ausländischer Unternehmer im Zuge seines Projekts Waren nach Österreich verbringt oder dort zukauft. Auch wenn das eigentliche Projekt über Reverse Charge an einen Unternehmer abgerechnet wird, können innergemeinschaftliche Warenbewegungen oder Importe nach Österreich eine Registrierung auslösen. Beispielsweise: Ein deutscher Anlagenbauer bringt eigene Teile nach Österreich mit, um sie beim Kunden zu installieren. Wird diese Warensendung als innergemeinschaftliche Lieferung nach Österreich ausgeführt, muss der ausländische Unternehmer grundsätzlich in Österreich einen innergemeinschaftlichen Erwerb versteuern. Um dies abzuwickeln, ist eine UID-Nummer nötig. In solchen Fällen empfiehlt es sich, einen steuerlichen Vertreter hinzuzuziehen, der bei der Gestaltung (z.B. der Wahl des Lieferweges oder der Importabwicklung) beratend unterstützt. Gegebenenfalls kann der österreichische Kunde den Import der Waren übernehmen, um dem ausländischen Lieferanten die Registrierung zu ersparen. Diese Details zeigen: Registrierungsfragen rund um Werklieferungen sollten im Voraus mit Experten geklärt werden.
Rolle des Fiskalvertreters in Österreich
Für ausländische Unternehmen, die in Österreich umsatzsteuerliche Pflichten erfüllen müssen, spielt der Fiskalvertreter in Österreich eine zentrale Rolle. Ein Fiskalvertreter (steuerlicher Vertreter) ist ein in Österreich ansässiger Bevollmächtigter, der im Namen des ausländischen Unternehmens die steuerlichen Agenden übernimmt. Insbesondere für Unternehmen mit Sitz außerhalb der EU ist die Bestellung eines Fiskalvertreters verpflichtend, um überhaupt eine UID-Nummer zu erhalten. Aber auch EU-Unternehmen ohne Betriebsstätte in Österreich ziehen häufig freiwillig einen Fiskalvertreter hinzu, um Risiken zu minimieren und den Verwaltungsaufwand auszulagern. In der Praxis übernimmt häufig ein Wirtschaftstreuhänder (Steuerberater) diese Rolle, da er über das nötige Know-how verfügt und auch rechtlich als Zustellungsbevollmächtigter auftritt.
Die Aufgaben eines Fiskalvertreters in Österreich umfassen unter anderem:
- Umsatzsteuer-Registrierung: Er beantragt für das ausländische Unternehmen die österreichische UID und richtet alle notwendigen Meldungen beim Finanzamt ein.
- Laufende Buchführung und Meldungen: Der Fiskalvertreter sorgt dafür, dass sämtliche Umsatzsteuervoranmeldungen (UVA) fristgerecht eingereicht (je nach Umsatz monatlich oder vierteljährlich) und die Steuerbeträge pünktlich abgeführt werden. Auch Jahreserklärungen und Zusammenfassende Meldungen, falls erforderlich, werden von ihm erstellt.
- Kommunikation mit den Behörden: Als lokaler Ansprechpartner übernimmt der Fiskalvertreter die Korrespondenz mit dem Finanzamt und anderen öffentlichen Stellen, z.B. im Falle von Rückfragen oder Prüfungen.
- Beratung und Compliance: Ein guter Fiskalvertreter in Österreich berät das Unternehmen zudem hinsichtlich der optimalen umsatzsteuerlichen Gestaltung. Er klärt über die Anwendung des Reverse-Charge-Verfahrens auf, prüft Rechnungen auf österreichische Anforderungen und hilft, Fehler (etwa falsche Steuersätze oder fehlende Pflichtangaben) zu vermeiden.
Durch die Einschaltung eines Fiskalvertreters stellt ein ausländischer Anlagenbauer sicher, dass er alle lokalen Steuerpflichten korrekt erfüllt. Gerade bei größeren Anlagenbau-Projekten mit hohen Beträgen gibt dies Sicherheit: Sämtliche Umsatzsteuerbeträge werden richtig behandelt, Fristen werden nicht versäumt, und das Unternehmen kann sich auf sein Kerngeschäft konzentrieren. Der Begriff „Fiskalvertreter in Österreich“ steht damit für einen Schlüsselpartner, der die Brücke zwischen ausländischem Unternehmen und österreichischer Steuerbehörde baut.
Nicht zuletzt hilft ein Fiskalvertreter auch dabei, sprachliche und administrative Hürden zu überwinden, da sämtliche Behördenformalitäten in Österreich auf Deutsch ablaufen.
Typische Fallbeispiele aus dem Anlagenbau
Zum besseren Verständnis der Praxis sollen einige Fallbeispiele verdeutlichen, wie Werklieferungen im Anlagenbau in unterschiedlichen Konstellationen umsatzsteuerlich behandelt werden:
- Beispiel 1: Deutscher Anlagenbauer mit österreichischem Unternehmer als Kunden (B2B) – Eine deutsche Maschinenbaufirma liefert und montiert eine Fertigungsanlage bei einem österreichischen Industriebetrieb. Der Ort der Leistung ist Österreich, also liegt eine steuerbare Werklieferung in Österreich vor. Der österreichische Kunde ist jedoch ein vorsteuerabzugsberechtigter Unternehmer mit UID-Nummer. Es greift somit das Reverse-Charge-Verfahren. Der deutsche Anlagenbauer fakturiert den Auftrag netto (ohne österreichische Umsatzsteuer) und vermerkt auf der Rechnung „Reverse Charge – Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers“ sowie die UID seines Kunden. Eine eigene Registrierung in Österreich ist in diesem Fall nicht erforderlich. Der österreichische Unternehmer schuldet die Umsatzsteuer und kann sie in der Regel im selben Zug als Vorsteuer abziehen.
- Beispiel 2: US-Anlagenbauer mit österreichischem Unternehmen als Kunden (B2B) – Ein Unternehmen aus den USA installiert eine neue Anlage in einem österreichischen Werk. Obwohl der Lieferant außerhalb der EU ansässig ist, unterscheidet sich die umsatzsteuerliche Behandlung nicht vom vorherigen Beispiel: Handelt es sich beim österreichischen Kunden um einen Unternehmer oder eine juristische Person, so wendet man ebenfalls Reverse Charge an. Die US-Firma stellt also eine Rechnung ohne Umsatzsteuer aus, und der österreichische Kunde übernimmt die Steuerschuld. Wichtig ist hier die Abstimmung bei der Importabwicklung: Da die Maschinenkomponenten aus dem Nicht-EU-Ausland eingeführt werden, sollte im Vorfeld festgelegt werden, wer die Einfuhr vornimmt und die EUSt (Einfuhrumsatzsteuer) entrichtet. Häufig übernimmt der österreichische Kunde die Rolle des Importeurs, da er die Einfuhrumsatzsteuer als Vorsteuer abziehen kann. So muss sich der US-Anlagenbauer nicht selbst um die Importsteuer kümmern. Eine österreichische Umsatzsteuerregistrierung wäre für die US-Firma nur dann notwendig, wenn sie zusätzlich in Österreich steuerpflichtige Umsätze ohne Reverse Charge tätigt oder Vorsteuern zurückfordern möchte.
- Beispiel 3: Schweizer Anlagenbauer mit Privatkunde in Österreich (B2C) – Eine Schweizer Firma liefert und montiert eine automatische Toranlage bei einem österreichischen Privathaushalt. Hier ist der Leistungsort ebenfalls Österreich, womit grundsätzlich österreichische Umsatzsteuer anfällt. Anders als in den B2B-Fällen kann der Schweizer Unternehmer das Reverse-Charge-Verfahren nicht nutzen, da der Leistungsempfänger keine Firma, sondern eine Privatperson ist. Folglich muss die Schweizer Firma sich vorab in Österreich umsatzsteuerlich registrieren und einen Fiskalvertreter in Österreich bestellen. Die Rechnung an den Kunden wird mit 20% österreichischer USt ausgestellt. Die Schweizer Firma muss diese Steuer an das Finanzamt melden und abführen (in der Regel über ihren Fiskalvertreter). Zwar kann sie in diesem Szenario ihre eigenen in Österreich angefallenen Vorsteuern (z.B. für Materialeinkäufe oder Zoll) geltend machen, doch der administrative Aufwand ist erheblich. Dieses Beispiel zeigt, dass man private Auftraggeber in Österreich nur mit vorheriger steuerlicher Planung bedienen sollte. (Hinweis: Wäre der ausländische Lieferant in diesem Beispiel ein EU-Unternehmen, würde zwar ebenfalls Registrierungspflicht bestehen, jedoch könnte auf die Bestellung eines Fiskalvertreters verzichtet werden. Viele EU-Unternehmen beauftragen dennoch freiwillig einen Fiskalvertreter in Österreich, um die Abwicklung zu erleichtern.)
- Beispiel 4: Reine Montageleistung ohne eigene Materiallieferung – Ein polnisches Montageteam baut in Österreich eine Produktionsanlage zusammen, wobei alle Hauptkomponenten vom österreichischen Auftraggeber gestellt werden. In diesem Fall liegt keine Werklieferung, sondern eine Werkleistung (Dienstleistung) vor, da der polnische Unternehmer keine wesentlichen eigenen Materialien einsetzt. Der Leistungsort dieser Montageleistung befindet sich ebenfalls in Österreich (Ort der tätigen Arbeit). Umsatzsteuerlich greift auch hier im B2B-Fall das Reverse-Charge-Verfahren: Der österreichische Unternehmer schuldet die Steuer, während der polnische Dienstleister netto fakturieren kann. Eine Registrierung in Österreich ist für das polnische Unternehmen nicht erforderlich, sofern keine weiteren steuerpflichtigen Umsätze in Österreich erbracht werden.
Die Fallbeispiele verdeutlichen: Ob eine Werklieferung in Österreich für den ausländischen Unternehmer umsatzsteuerliche Pflichten auslöst, hängt entscheidend vom Status des Kunden (unternehmerisch oder privat) und von der Abwicklung der Warenbewegungen ab. In vielen B2B-Fällen entlastet das Reverse-Charge-Verfahren den ausländischen Anlagenbauer von der direkten Steuerabfuhr in Österreich. In anderen Situationen hingegen ist eine genaue Kenntnis der Regeln und fristgerechte Erfüllung der Pflichten unabdingbar, um Probleme zu vermeiden.
Zusammenfassend wird deutlich, dass ausländische Unternehmer für Werklieferungen in Österreich eine saubere steuerliche Planung benötigen. Die Anwendung des Reverse-Charge-Verfahrens in den meisten B2B-Fällen erleichtert zwar die Abwicklung, doch müssen dennoch alle Formalitäten genau eingehalten werden. Bei Unsicherheiten ist es empfehlenswert, rechtzeitig Expertenrat einzuholen, um spätere Steuernachforderungen und Sanktionen zu vermeiden.
Praktische Umsetzung und Tipps
Abschließend einige praktische Tipps, wie ausländische Anlagenbauer Werklieferungen in Österreich erfolgreich und compliant abwickeln können:
- Leistungsort prüfen: Definieren Sie bereits im Vertrag klar, welche Leistungen (Lieferung, Montage, etc.) Sie erbringen. Dies beeinflusst die steuerliche Beurteilung. Analysieren Sie außerdem zu Beginn jedes Projekts, ob eine Werklieferung im umsatzsteuerlichen Sinne vorliegt und ob der Leistungsort in Österreich liegt. Ist eine Montage in Österreich Teil der Leistung, dann planen Sie von Anfang an mit dem österreichischen Umsatzsteuerrecht.
- Kundenstatus klären (B2B vs. B2C): Ermitteln Sie, ob Ihr österreichischer Kunde Unternehmer (mit UID) oder Privatkunde ist. Entsprechend richtet sich die steuerliche Abwicklung: Bei B2B unbedingt die UID des Kunden einholen und das Reverse-Charge-Verfahren anwenden. Bei B2C planen Sie zusätzlich Zeit für die Steuerregistrierung ein.
- Umsatzsteuer-Registrierung rechtzeitig beantragen: Falls eine Registrierung in Österreich erforderlich ist, kümmern Sie sich frühzeitig darum. Die Vergabe einer UID kann einige Wochen dauern. Bereiten Sie alle notwendigen Unterlagen vor (u.a. Identitätsnachweis des Unternehmens, Vollmacht für den Fiskalvertreter, Beschreibung der Tätigkeit in Österreich).
- Fiskalvertreter in Österreich einsetzen: Insbesondere für Nicht-EU-Unternehmen ist ein Fiskalvertreter Pflicht. Aber auch EU-Unternehmen sollten in Erwägung ziehen, einen Fiskalvertreter in Österreich zu engagieren. Dieser unterstützt bei der Registrierung, führt die Kommunikation mit dem Finanzamt und stellt sicher, dass alle Fristen und Pflichten eingehalten werden.
- Rechnungsstellung korrekt gestalten: Stellen Sie Ihre Rechnungen entsprechend der österreichischen Vorgaben aus. Bei Reverse Charge dürfen keine Steuerbeträge ausgewiesen sein; vermerken Sie stattdessen den Grund („Reverse Charge“) und die UID des Kunden. Bei Rechnungen mit österreichischer Umsatzsteuer muss Ihre eigene österreichische UID-Nummer auf der Rechnung stehen, und der Steuersatz ist offen auszuweisen. Achten Sie in allen Fällen auf vollständige Pflichtangaben (Name und Anschrift beider Parteien, Leistungsdatum, Entgelt, etc.), um den Vorsteuerabzug beim Kunden nicht zu gefährden. Achten Sie auch bei Anzahlungs- oder Teilrechnungen auf die gleichen Regeln: Im Reverse-Charge-Fall dürfen Sie keine Steuer ausweisen; müssen aber ggf. auf der Rechnung vermerken, wofür die Anzahlung ist. Wenn Sie selbst die Steuer schulden, ist die österreichische USt schon auf die Anzahlung auszuweisen und abzuführen.
- Dokumentation und Meldepflichten erfüllen: Führen Sie genaue Aufzeichnungen über die in Österreich erbrachten Umsätze und Vorsteuern. Reichen Sie alle erforderlichen Meldungen ein (UVA, Jahreserklärung, gegebenenfalls Zusammenfassende Meldungen oder Intrastat-Meldungen bei Warenbewegungen). Versäumnisse können zu empfindlichen Strafen führen.
- Expertenrat nutzen: Umsatzsteuerrecht im internationalen Kontext ist komplex. Scheuen Sie nicht, fachkundigen Rat von einem österreichischen Steuerberater oder Ihrem Fiskalvertreter einzuholen. Dadurch können Sie Steuerfallen vermeiden – etwa eine falsche Beurteilung eines Geschäfts als steuerfrei – und sicherstellen, dass Ihr Projekt von Anfang an korrekt aufgesetzt ist.
- Vorsteuer-Rückerstattung bedenken: Falls Sie aufgrund von Reverse Charge keine eigene Registrierung in Österreich haben, können Sie dennoch etwaige in Österreich gezahlte Vorsteuerbeträge zurückholen. EU-Unternehmen nutzen dafür das elektronische Vorsteuerrückerstattungsverfahren über das Portal ihres Heimatlandes. Nicht-EU-Unternehmen können einen Antrag auf Vorsteuervergütung gemäß der 13. EU-Richtlinie stellen. Lassen Sie sich dabei von Ihrem Fiskalvertreter unterstützen, um alle Fristen und Formalitäten einzuhalten.
Mit diesen Maßnahmen können ausländische Unternehmen ihre Werklieferungen in Österreich reibungslos abwickeln. Die Kombination aus guter Planung, Kenntnis der Vorschriften und professioneller Unterstützung (durch einen Fiskalvertreter in Österreich) gewährleistet, dass sowohl die Kundenzufriedenheit als auch die Compliance mit dem Finanzamt sichergestellt sind.